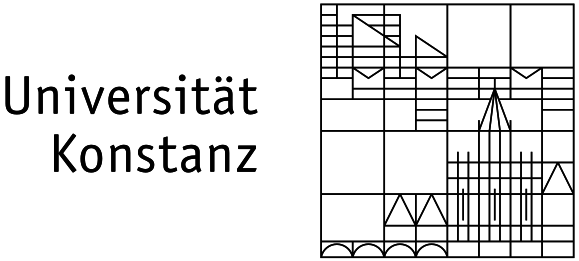Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
Bitte beachten Sie, dass sich alle Zeitangaben auf die Zeitzone des Konferenzortes beziehen.
Die momentane Konferenzzeit ist: 01. Mai 2025 17:24:22 MESZ
|
|
|
Sitzungsübersicht |
| Datum: Mittwoch, 11.09.2024 | |
| 12:00 - 17:00 | Öffnung Registrierungsdesk mit Tagungsservice Ort: Gebäude R Ebene 5 |
| 12:00 - 17:00 | Zusätzliche Informationen zur Registrierung |
| 14:00 - 16:30 | BARCAMP Ort: R0712 Chair der Sitzung: Anna Bergstermann, Frankfurt University of Applied Sciences Chair der Sitzung: Ilona Arcaro, TH Köln Barcamp-Sessions auf Ebene D4 in folgenden Räumen: D0434 (112 P),D0431 (24 P), D0432 (48 P), D0433 (38 P), D0435 (18 P), D0436 (34 P), C0422 (24 P) |
| 17:30 - 18:15 | Rahmenprogramm: Hafenrundfahrt im Konstanzer Trichter mit dem Linienverkehrs Schiff |
| 17:30 - 19:00 | Rahmenprogramm: Stadtführung „Klassische Sehenswürdigkeiten in Konstanz" |
| 19:00 | Rahmenprogramm: Empfang Stadt Konstanz Stadt Konstanz |
| Datum: Donnerstag, 12.09.2024 | |||||||
| 8:00 - 11:00 | Öffnung Registrierungsdesk mit Tagungsservice Ort: Gebäude R Ebene 5 | ||||||
| 8:00 - 11:00 | Zusätzliche Informationen zur Registrierung | ||||||
| 9:00 - 9:30 | Eröffnung und Begrüßung Ort: R0712 Eröffnung und Begrüßung
durch:
| ||||||
| 9:30 - 10:30 | Keynote Ort: R0712 Chair der Sitzung: Dr. Ulrich Wacker, Universität Konstanz Microcredentials: A New Challenge for Higher Education Prof. Dr. Carlos Delgado-Kloos, Universidad Carlos III de Madrid -Englisch, Rückfragen können auch in deutscher Sprache gestellt werden- | ||||||
| 10:30 - 10:45 | Posterpitch Ort: R0712 Chair der Sitzung: Christina Blake, Universität Konstanz Poster | ||||||
|
|
Anpassung der Eignungsprüfung in weiterbildenden Masterstudiengängen - ein dienstleistungsorientierter Ansatz Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland An der Frankfurt UAS werden seit mehr als 10 Jahren weiterbildende Masterstudiengänge angeboten. Wie im hessischen Hochschulgesetz definiert, öffnet sich die akademische Weiterbildung ebenfalls für nicht traditionelle Zielgruppen, insbesondere den beruflich Qualifizierten ohne ersten Studienabschluss. Für die Weiterbildungsabteilung der Frankfurt UAS ergaben sich in den letzten Jahren auf Grundlage der angebotenen und durchgeführten Eignungsprüfung, Rückschlüsse aus Beobachtungen und Rückmeldung der Kandidatinnen sowie Unternehmen, welche eine Anpassung der Eignungsprüfung notwendig macht. Das Poster stellt das Ergebnis einer wissenschaftlichen Arbeit zum o.g. Thema dar und beleuchtet insbesondere folgende Fragen: Wie kann eine Eignungsprüfung für den Weiterbildungsmarkt von wissenschaftlicher Weiterbildung attraktiver gestaltet werden? Und wie kann die Eignungsprüfung ökonomisiert werden, ohne die Qualitätsstandards von Wissenschaft und Forschung der Hochschule zu vernachlässigen? BioMex – ein innovatives Weiterqualifizierungsprogramm von internationaler Tragweite zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund, Deutschland Wie kann Fachpersonal gut weiterqualifiziert werden? Das rheinland-pfälzische Partnerland Ruanda strebt an, sich zu einem afrikanischen Zentrum der Biotechnologie und Pharmazie zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Initiative stehen daher sowohl der Ausbau von Forschungskapazitäten und neuen Produktionsanlagen, v.a. im Bereich der Impfstoffproduktion, als auch die Weiterqualifizierung des Fachpersonals, um internationale Qualitätsstandards sicherzustellen. Dem Wunsch nach Sicherung des Fachkräftebedarfs kommt ein neues Zertifikatsprogramm entgegen, das mit einem sehr hohen Flexibilisierungsgrad bedarfsgerechte Weiterbildung anbietet. Studierende und bereits tätige Fachkräfte können aus verschiedenen englischsprachigen Modulen aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Gebäude- und Energiemanagement, Management und interkulturelle Zusammenarbeit wählen. Die Module sind bestehenden, akkreditierten Studienprogrammen entnommen und lassen sich orts- und zeitunabhängig online im Blended-Learning-Format studieren. Multimediale Elemente im E-Learning ermöglichen variable Zugänge und reichern komplexe Themen an. Dabei ist das Zertifikatsprogramm so flexibel aufgebaut, dass sich ganz individuelle fachliche Qualifizierungen erwerben lassen – Micro-Degrees lassen sich nach Interessen beliebig kombinieren, höhere Abschlüsse wie ein CAS sind kumulativ zu erreichen. Das Programm startet im Frühjahr 2024 in Ruanda, und soll perspektivisch auch für Studierende in Deutschland geöffnet werden, womit sich spannende Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit und des interkulturellen Austauschs ergeben, die weit über die aktuelle Zielsetzung hinausgehen.
Komplementäre biografische Angebote in Ergänzung zum wissenschaftsbasierten Seniorenstudium LMU München, Deutschland Das Seniorenstudium der LMU München bietet akademisch Interessierten ein differenziertes Bildungsangebot. Der Fokus liegt auf der Vermittlung und Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber eine wichtige Ergänzung bieten Arbeits- und Gesprächskreise, insbesondere Veranstaltungen des autobiografischen Schreibens. Hier sind neben den subjektiven emotionalen Erinnerungen auch deren Reflexion und lebensweltliche Einordnung zentral (Behrendt/Kreitz, 2021). Die Beschäftigung mit der eigenen Biografie und die Einordnung dieser in das soziale Umfeld sowie den historischen Zusammenhang (Alheit/Dausien 2023) kann zu Empowerment führen und hat positive Wirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit (Pennbaker, 1997). Das Münchner Zentrum Seniorenstudium hat die Bedeutung und Bereicherung der biografischen Arbeit erkannt und ihr Raum gegeben: Neben der Veröffentlichung zweier Anthologien, verfassten Seniorenstudierende im Rahmen des Flower Power Festivals der Stadt München 2023 autobiografische Texte, die das Erleben der 1960er Jahre thematisierten. Daten einer eigenen Studierendenbefragung im Sommersemester 2023 zeigen positive Auswirkungen der Teilnahme an Arbeits- und Gesprächskreisen: Die biografischen Veranstaltungen wirken aktivierend, u. a. weil soziale Kontakte nachhaltig aufgebaut werden und weil sich die reflektierende Mitarbeit in den Lehrveranstaltungen verstärkt. Auch die Sicht auf das Älterwerden verändert sich intensiver als bei den anderen Teilnehmenden der Befragung.
Qualitätssiegel für wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung an staatlichen Hochschulen und Akademien in Baden-Württemberg EVALAG (Evaluationsagentur Baden-Württemberg), Deutschland Organisationstheorien wie der Neoinstiutionalismus (Meyer & Rowan 1977) belegen die steigende organisationale, politische und gesellschaftliche Relevanz von Zertifizierungen. Im Rahmen von Hochschulweiterbildung@BW (2022-2024) verantwortet EVALAG die Qualitätsentwicklung und hat ein Qualitätssiegel für wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung an staatlichen Hochschulen und Akademien in Baden-Württemberg implementiert. Mit dem Siegel wurden bereits vier Hochschulen bzw. Programme zertifiziert. Das Poster gibt einen Überblick über die Verfahrensarten, wobei entweder Institutionen oder Angebote zertifiziert werden können. Die institutionelle Zertifizierung von Weiterbildungseinrichtungen überprüft und bestätigt die wirksame Etablierung von Verfahren, Prozessen und Instrumenten zur Qualitätssicherung ihrer Angebote. Kriterien sind Ziele und Profil der Einrichtung, Governance und Steuerung, Ressourcen, Lehre und Lernen sowie Qualitätssicherung. Die Zertifizierung von wissenschaftlichen Weiterbildungsangeboten überprüft die Kongruenz von Konzeption und Qualifikationszielen sowie die Effektivität in der Umsetzung. Sie bestätigt, dass die angestrebten Qualifikationsziele und das gewünschte Kompetenzprofil erreicht werden können und stellt fest, auf welcher Niveaustufe des Deutschen Qualifikationsrahmens diese Kompetenzen eingeordnet werden können. Die Zertifizierungskriterien sind: Programmprofil, Curriculum, Prüfungssystem, Organisation des Weiterbildungsangebots, Ressourcen sowie Qualitätssicherung. Zudem werden Lessons Learnt und Good Practices aus den Zertifizierungsverfahren im Poster vorgestellt und eine potentielle Anschlussfähigkeit für andere Bundesländer und Länder reflektiert.
Zukunftsweisende Bildungswege: Die Qualifizierungsmatrix für den Batteriesektor 1Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung; 2Institut für Forschung, Training und Projekte (iftp) im bfw Das iftp im bfw hat als Partner der beruflichen Weiterbildung in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der BTU eine Qualifizierungsmatrix für berufliche Weiterbildungsangebote im Batteriesektor entwickelt. Diese wird im Projekt “KOMBiH – Kompetenzaufbau für Batteriezellfertigung in der Hauptstadtregion” genutzt, um den Rahmen für ein kollaborativ entwickeltes Kursangebot zu schaffen. Die Qualifizierungsmatrix beschreibt den konzeptionellen Ansatz des Projekts, berufliche Qualifizierung als durchlässiges, flexibles System zu denken, das den diversen Bildungs- und Erwerbsbiografien von Beschäftigten und ihren komplexer werdenden beruflichen Tätigkeitsbereichen gerecht wird. Unterschiedliche Bildungspfade zeigen Wege für vergleichbare und zertifizierte Hochschul- und Kammer-Abschlüsse auf. Das Poster zeigt ein modular angelegtes Qualifizierungsprogramm, welches passgenau und situativ auf die konkreten Bedarfe der jeweiligen beruflichen Beschäftigtengruppen zugeschnitten ist. Innerhalb des Projektes werden dafür Technologien wie Virtual Reality, 360°-Touren oder interaktive spielerische Anwendungen genutzt, um adaptiver auf die Vielfalt reagieren zu können. Die Qualifizierungsmatrix veranschaulicht dabei den Brückenschlag zwischen akademischer und beruflicher Aus- bzw. Weiterbildung. Die modulare Qualifizierungsmatrix bildet die Grundlage für zertifizierungsfähige Weiterbildungsangebote der Beschäftigten. Sollten Teilnehmende bereits Kompetenzen in formalen, non-formalen und informellen Kontexten entwickelt haben ist es möglich diese im Rahmen der Qualifikation anrechnen zulassen.
Lieben lernen - Lieben lehren: Sexuelle Gesundheit, sexuelles Wohlbefinden und Prävention von sexualisierter Gewalt als Ziel schulischer sexueller Bildung Hochschule Merseburg, Deutschland Schule hat einen sexualerzieherischen Auftrag, der weit über Aufklärung zu biologisch-körperlichen Prozessen hinausgeht. Lehrer*innen und auch andere pädagogische Fachkräfte sollten daher kompetente Vertrauenspersonen für Schüler*innen sein. Im Idealfall begleiten Lehrkräfte die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu verantwortungsvollen und selbstbestimmten Persönlichkeiten im Umgang mit Liebe, Sexualität und Beziehungen und leisten damit auch einen wertvollen Beitrag für einen grenzachten Umgang und zur Prävention sexualisierter Gewalt. Bis dato sind sie oftmals jedoch nicht ausreichend qualifiziert oder spüren persönliche Hemmnisse, das Thema Sexualität im schulischen Kontext professionell aufzugreifen. Denn: Sexuelle Bildung ist bisher kaum Gegenstand der Lehramtsbildung. Das Curriculum „Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0 – Lieben lernen | Lieben lehren“ eignet sich insbesondere für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und entspricht aktuellen wissenschaftlichen Standards und Bedarfen in den Themenfeldern Sexuelle Bildung, sexuelle Selbstbestimmung sowie Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt. Eine Adaption für weiteres schulisches Personal und anderweitig tätige pädagogische Fachkräfte ist möglich und wünschenswert.
| ||||||
| 10:45 - 11:15 | Kaffeepause mit Postergalerie Ort: Gebäude D Ebene 4 | ||||||
| 11:15 - 12:45 | Dynamisierung von Angeboten – Lehrkräfte Ort: D0435 Chair der Sitzung: Dr. Monica Bravo Granström, Pädagogische Hochschule Weingarten Vorträge | ||||||
|
|
Innovative Dynamik zwischen Hochschul- und Weiterbildungsbereich im Feld der Integration internationaler Lehrkräfte im Projekt IGEL Pädagogische Hochschule Weingarten, Deutschland Die Integration internationaler Lehrkräfte (iLK) stellt die Beteiligten vor einige Herausforderungen. Das Programm IGEL der Pädagogische Hochschule Weingarten, in Kooperation mit der Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung und gefördert vom DAAD, begleitet seit 2019 iLK beim Wiedereinstieg in den Beruf. Als Brückenprogramm unterstützt es beim (Re-)Qualifizierungsprozess mit Beratung, Studienvorbereitung und -begleitung sowie Bewerbungshilfe. Mit dem Programm trägt die PH Weingarten zur Verantwortung für ein diversitätsoffenes Bildungssystem bei. Dies geschieht an der Schnittstelle wissenschaftlicher Lehrkräfteausbildung und wissenschaftlicher Weiterbildung, denn das Programm folgt Studiennachforderungen der Schulaufsicht sowie dem Wunsch nach schulnahen Fortbildungsangeboten. Die Begleitforschung (Kansteiner et al., 2022) zeigt, dass alle iLK eine Adaption an die Studien- und Schulanforderungen vollziehen, dies jedoch auf sehr individuellen Wegen. Das IGEL-Team, bestehend aus Lehrkräftebildner:innen und anderem wiss. Personal, stützt dabei eine bisher wenig traditionelle Zielgruppe des Studiums, die zukünftig (nicht zuletzt auch angesichts der Entwicklung der Quereinstiege im Schulsystem) eine ‚normale‘ Zielgruppe darstellen könnte. Im IGEL-Projekt zeigt sich eine innovative Dynamik zwischen der Lehrkräftebildung und Weiterbildung, aus der Impulse für ein reflexives Diversity Management an der Hochschule ergehen. Innovationskraft entfaltet sich zwischen Hochschul- und Weiterbildungsbereich. Der Vortrag beleuchtet entsprechende Erkenntnisse der innovativen Wechselwirkung sowie die Neuausrichtung von IGEL mit Perspektiven für zukünftige Integrationsarbeit.
Professionalisierung der Lehre in der wissenschaftlichen Weiterbildung: Impulse aus einer Befragung der Lehrenden und einer Veranstaltungsreihe in Baden-Württemberg EVALAG (Evaluationsagentur Baden-Württemberg), Deutschland Die Zielgruppe der wissenschaftlichen Weiterbildung unterscheidet sich von jener grundständiger Studiengänge. Teilnehmende in der wissenschaftlichen Weiterbildung verfügen i.d.R. über Berufserfahrung, sind Fach- und/oder Führungskräfte, weisen generell eine höhere Diversität auf und haben daher spezifische Anforderungen an Lehren und Lernen. Diese Anforderungen machen eine Professionalität für die spezifische Zielgruppe notwendig. Im Rahmen von Hochschulweiterbildung@BW (2022-2024) verantwortet EVALAG (Evaluationsagentur Baden-Württemberg) die Professionalisierungsangebote für Lehrende in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Um deren spezifische Bedarfe zu analysieren, wurde 2023 eine Online-Befragung der Lehrenden mit einer Stichprobe von 189 Personen durchgeführt. Im Vortrag werden ausgewählte Erkenntnisse dieser Befragung und deren deskrivptive Auswertung vorgestellt:
EVALAG hat auf Grundlage der Befragung und eines regelmäßigen Austausches mit Vertreter:innen der Didaktikzentren für Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Professionalisierungsangebote für die Lehre in diesem Bereich entwickelt. Im Rahmen des Vortrages werden die konzipierten Angebote vorgestellt, um damit auf Chancen und Herausforderungen in der Umsetzung einzugehen.
| ||||||
| 11:15 - 12:45 | Dynamisierung von Angeboten – Bedarfe Ort: D0434 Chair der Sitzung: Anika Schünemann, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg Vorträge | ||||||
|
|
Bedarfe von Hochschulabsolvent*innen in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Das Instrument Absolvent*innenbefragung als Indikator für dynamische Veränderungen. Fachhochschule Oberösterreich, Österreich In der wissenschaftlichen Weiterbildung ist es für Hochschulen/Universitäten ein Erfordernis, die ständig veränderten Bedürfnisse der Zielgruppe(n) zu erkennen, zu verstehen und entsprechend in den Weiterbildungsprogrammen zu berücksichtigen. Gleichzeitig agieren Hochschulen im Bereich der wiss. Weiterbildung in einem hoch kompetitiven Wettbewerbsmarkt, der es erforderlich macht, den Markt, die Anbieter und technologische, gesellschaftliche und soziale Veränderungen im Blick zu haben. Flexibel agieren, Lernorientierung im Fokus haben, strategisch orientiert und kooperativ als Hochschule zu handeln, sind dabei Schlüsselkompetenzen der dynamischen Veränderungen in diesem Bereich. Eine der wichtigsten Zielgruppen in der wiss. Weiterbildung sind Alumni bzw. Postgraduates, die bereits über einen ersten hochschulischen Abschluss verfügen und mehrere Jahre Berufstätigkeit aufweisen können. Doch wie können die Bedarfe und Interessen kontinuierlich erfasst werden? Was wissen Hochschulen über ihre Alumni im Hinblick auf Weiterbildungsbedarfe und Interessen? Eine der zentralen Maßnahmen für Hochschulen sind dabei Absolvent*innenbefragungen. Im eingereichten Vortrag wird eine 2022 durchgeführte Absolvent*innenbefragung (repräsentative Vollerhebung an über 20.000 Absolvent*innen) der Fachhochschule Oberösterreich vorgestellt. Dabei werden die Ausgangssituation mit den strategischen Herausforderungen reflektiert, die Ergebnisse der Motive, Interessenslagen und Erwartungshaltungen (Anforderungen) präsentiert. Die Erkenntnisse dieses Projektes können als Empfehlungen für andere Hochschulen abgeleitet werden, die sich im Bereich der wiss. Weiterbildung strategisch positionieren möchten. ENTFÄLLT - Personalmanagement als Zielgruppe für Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung CBS International Business School, Deutschland In den Personalabteilungen von Unternehmen liegen reichhaltige Erfahrungen der Nutzung hochschulischer Bildungsangebote vor. Die dahinterliegenden Angebotsphänomene können durch die Stichworte Corporate Universities, Business Schools, Bachelor-Master-Struktur und duales Studium skizziert werden. Aufgrund des akuten branchenübergreifenden Fachkräftemangels entwickelt sich in Unternehmen eine zunehmende Bereitschaft, wissenschaftliche Weiterbildung als Instrument zur Personalgewinnung, -bindung und -entwicklung einzusetzen. Das Personalmanagement in einem Unternehmen steht vor der Aufgabe, zu entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen die Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung den Beschäftigten zugänglich gemacht werden. Um das Personalmanagement als Zielgruppe zu erschließen, stehen andererseits Hochschulen vor der Aufgabe, ein Verständnis für die Problem- und Entscheidungssituation des Personalmanagements zu entwickeln sowie die Gestaltung und Kommunikation ihrer Angebote daran auszurichten. Eine Analyse der Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sowie der Datenstruktur des Weiterbildungsportals hoch & weit hat gezeigt, dass die Zielgruppe Personalmanagement bisher kaum adressiert wird. In dem Vortrag werden Merkmalsebenen der Angebote wissenschaftlicher Weiterbildung vorgestellt, die sich für die Erschließung der Zielgruppe Personalmanagement eignen. Hochschulen als Arbeitgeber - Dynamisierung der Weiterbildungen für das Hochschulpersonal Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Deutschland Wissenschaftliche Weiterbildung richtet sich an heterogene Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedarfen und Lernvoraussetzungen und möchte einen Beitrag zu einem bedarfsgerechten Up- und Reskilling mit vielfältigen (Kooperations-)Angeboten leisten. Hochschulen richten originär ihre Initiative an Lernenden aus, die an die Institution zum lebensbegleitenden Lernen kommen. Dieser Beitrag richtet den Blick nach innen – Hochschule als Arbeitgeberin mit Verantwortung für Personalentwicklung – und fokussiert das eigene Hochschulpersonal als Lernende mit ihren heterogenen Belangen und Wünschen für die eigene Entwicklung als agierende Personen in der Institution Hochschule und den dafür möglichen Beitrag durch Weiterbildung als institutionell verankerte zentrale Aufgabe. Im Rahmen einer hochschulinternen Evaluation sind alle Mitarbeitenden angesprochen worden, ihre Akzeptanz und ihr Nutzungsverhalten in Bezug zur internen Weiterbildung sowie die Bedeutung von erlebten Lernprozessen und Lerntransfer für die eigene berufliche Entwicklung einzuschätzen, auch gespiegelt an aktuellen Entwicklungen und der individuellen Bedeutsamkeit, wie bspw. Future Skills. Anlass ist die nutzungsorientierte Ausrichtung des internen Weiterbildungsprogramms in Themen, Formaten, Orten und Kooperationen. Eine wesentliche Grundlage bilden die nutzungsfokussierten Evaluationsergebnisse. In dem Beitrag werden die Methodik der Evaluation und relevante Ergebnisse vorgestellt, bevor Anknüpfungspunkte und Fragen zur Dynamisierung und Ausrichtung von Angeboten und Strukturen der internen Weiterbildung aufgegriffen und diskutiert werden.
| ||||||
| 11:15 - 12:45 | Dynamisierung von Strukturen – Modelle Ort: D0432 Chair der Sitzung: Dr. Franziska Sweers, Philipps-Universität Marburg Vorträge | ||||||
|
|
Kompetenz Kommunale Integrationsarbeit (KKI) - Chancen, Herausforderungen und Grenzen eines Transferkonzeptes Hochschule-Verwaltung 1Universität Konstanz, Deutschland; 2Stabsstelle Integration Singen; 3Stabsstelle Integration Singen Der Beitrag stellt das KKI-Portfolio (Kompetenz Kommunale Integrationsarbeit) vor, das zwei Dimensionen umfasst: erstens praxisorientierte Lernbausteine im Format Microcredential für Integrationsbeauftragte, die sich didaktisch vorwiegend am Peer-to-Peer-Ansatz orientieren. Zweitens ein Informations- und Austauschportal, das sowohl Vernetzung als auch die Selbstorganisation und Selbstlernprozesse der Integrationsbeauftragen stärken soll. Ergänzende Dimension soll zudem ein Dialogformat sein, das Europa als Begegnungsraum für die Entwicklung des Integrationsdiskurses versteht und zur Erprobung und Ermöglichung von Bildungskooperationen beitragen soll.Ausgehed von der Präsentation sollen folgenden Fragen diskutiert werden: - Welche Optimierungsvorschläge ergeben sich für das KKI Angebot? - Was sind Herausforderungen in der Kooperation zwischen Wissenschaft und kommunaler Praxis? Welche Ableitungen lassen sich daraus für die gelingenden Wissenstransfer ziehen? - Welche Strategien der Zusammenarbeit sind rückblickend effektiv und welche welcher weniger zielführend? Was sind die Grenzen einer solchen Zusammenarbeit?
Von weiterbildenden Zertifikaten zum weiterbildenden Master. Der Mainzer „FlexiMaster“ als Struktur-Modell (Dynamiken in Angebotsentwicklung) Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), Deutschland Von weiterbildenden Zertifikaten zum weiterbildenden Master. Der Mainzer „FlexiMaster“ als Struktur-Modell (Dynamiken in Angebotsentwicklung) Niederschwelliger Zugang und hohe Flexibilität entlang des student-life-cycle, das sind aus Sicht Berufstätiger die Schlüsselwörter für erfolgsversprechende berufsbegleitende Weiterbildung. Um beides anzubieten, wurde der Mainzer FlexiMaster entwickelt. Der Weiterbildungs-Masterstudiengang Coaching – Training – Beratung. Prozessbegleitung von Personen, Teams und Organisationen (geplanter Start WS 24/25) ist zeitlich flexibel gestaltbar (Dauer von 6, 8 oder 10 Semestern). Verschiedene Zertifikatsstudiengänge (CAS) sind kumulierbar, ein individuelles Einfädeln in den weiterbildenden Master ist möglich. Das Hochschulgesetz RLP erlaubt beruflich Qualifizierten den direkten Einstieg in ein weiterbildendes Master-Studium. Vier CAS-Angebote des ZWW sind in den Master als Module integriert. Den Studierenden wird mit Abschluss des jeweiligen Moduls gleichzeitig ein Zertifikat für das korrespondierende CAS ausgestellt. Umgekehrt können Master-Interessierte zunächst als CAS-Teilnehmende einzelne Zertifikate erwerben und diese dann später in den Master einbringen. Der Master trägt den neuesten Studien zum erfolgreichen Studium Rechnung: theoriebasierte Lehrveranstaltungen, Reflexionsphasen, hohe Selbstlernphasenanteile, Lernen in Gruppen ergeben die geeignete inhaltliche und fachliche Struktur des Studiums.[1] Auch hinsichtlich der Prüfungskultur, den Lernarrangements und der Theorie-Praxis-Verzahnung ist dieses flexible Master-Format innovativ. [1] Vgl. Wissenschaftsrat: „Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre“, Köln 2022, S. 29ff.
Praktischer Ansatz für die Entwicklung & Implementierung von Micro Credentials in der wissenschaftlichen Weiterbildung Graduate Campus Hochschule Aalen GmbH, Deutschland In den vergangenen Jahren hat die steigende Nachfrage nach wissenschaftlichen Weiterbildungsprogrammen gezeigt, dass sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen ein wachsendes Interesse an kleinteiligen und flexiblen Weiterbildungsprogrammen haben. Diese Angebotslücke kann durch Micro Credentials geschlossen werden. Ihr Potenzial liegt insbesondere darin, lebenslanges Lernen zu fördern, Transparenz zu schaffen und nicht-traditionelle Zielgruppen in den Hochschulbereich zu integrieren. Das entwickelte Bildungsformat schließt eine Angebotslücke in der wissenschaftlichen Weiterbildung, indem es die Barrieren für nicht-traditionelle Zielgruppen reduziert und damit zur Dynamisierung der wissenschaftlichen Weiterbildung beiträgt. Ausgehend von diesen Bedürfnissen hat der Graduate Campus der Hochschule Aalen ein Modell für ein kleinteiliges und digitales Bildungsformat entwickelt, welches sich flexibel und bedarfsgerecht in den Arbeitsalltag integrieren lässt. Das Weiterbildungskonzept umfasst verschiedene Bausteine, wie Live-Online-Unterrichtseinheiten, E-Learning-Module, Praxistransferaufgaben und Experten-Coachings. Zudem kann es optional mit einem Hochschulzertifikat im Umfang von 2 ECTS abgeschlossen werden. Entstanden ist eine adaptierbare Formatvorlage für Micro Credentials, die als Best-Practice Beispiel verwendet werden kann. Im Vortrag werden Rahmenbedingungen, Formatbausteine, Herausforderungen sowie Grenzen der Integration in die bestehenden Hochschulstrukturen aufzeigt.
| ||||||
| 11:15 - 12:45 | Dynamisierung von Grenzen Ort: C0421 Chair der Sitzung: Thomas Bertram, Leibniz Universität Hannover Werkstattgespräch | ||||||
|
|
Die Überwindung starrer und Gestaltung fluider Grenzen wissenschaftlicher Weiterbildung durch Transdisziplinarität Hochschule Magdeburg-Stendal, Deutschland In Zeiten gesellschaftsstruktureller Transformationsprozesse, die eine steigende Komplexität, Ungewissheit und Kontingenz mit sich ziehen, stellt sich die Frage, inwiefern wissenschaftliche Weiterbildung diesen besonderen Herausforderungen entsprechen kann? Wir sind davon überzeugt, dass sie es sich nicht länger erlauben kann, weiterhin in festen (symbolischen) Grenzen, Strukturen und Aufgaben zu denken. Vielmehr gilt es, sich von essentialisierenden Vorannahmen und dichotomen Zuschreibungen zu lösen und eine relationale Perspektive einzunehmen, die einen gemeinsamen Herstellungsprozess (von Grenzen) betont. Nur dann wird sie in der Lage sein, innerhalb gesellschaftlicher Entwicklungsdynamiken flexibel zu agieren und diese sogar mitzugestalten. Eine solche relationale Perspektive hätte allerdings weitreichende konzeptionelle Konsequenzen (bspw. für die Angebotsentwicklung, die Zielgruppenkonzeption oder auch für Forschungsperspektiven), die bislang nicht hinreichend bearbeitet sind. In unserer Werkstatt möchten wir genau hier ansetzen und diese gemeinsam mit Akteur:innen aus den operativen und wissenschaftlichen Kontexten wissenschaftlicher Weiterbildung diskutieren. Wir werden uns also fragen, was die Konsequenzen und Herausforderungen bei der Umsetzung, Gestaltung, Finanzierung, Implementierung oder Verstetigung wären, wenn wir wissenschaftliche Weiterbildung als „offenes Konzept“ denken, welches erst durch die gemeinsamen Konstitutionsprozess von hochschulischen und außerhochschulischen Akteur:innen gestaltet wird.
| ||||||
| 11:15 - 12:45 | Dynamisierung von Grenzen Ort: C0422 Chair der Sitzung: Yvonne Weigert, Universität Leipzig Werkstattgespräch | ||||||
|
|
Transfer, Partizipation, Transdisziplinarität und Anwendungsorientierung als Gegenstand wissenschaftlicher Weiterbildung? TU Berlin, Deutschland Die Diskussionsveranstaltung widmet sich der zentralen Frage, welche Rolle Weiterbildung in der Befähigung akademischer Fachkräfte für die dritte Leistungsdimension "Transfer" spielen kann. Diese Dimension fordert von den Wissenschaften die Übernahme von Verantwortung für die Bearbeitung gesellschaftlicher Herausforderungen unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder, einschließlich nicht-akademischer Akteure. Unter den Schlagworten "Transfer", "Partizipation", "Transdisziplinarität" und "Anwendungsorientierung" werden entsprechende Aktivitäten nicht nur als relevant betrachtet, sondern zunehmend auch als Förderkriterium etabliert. In der Diskussion sollen unterschiedliche Aspekte im Anschluss an die Erfahrungen und Positionen der Teilnehmenden erörtert werden. Insbesondere soll der Frage nachgegangen werden, welche Rolle Weiterbildungsangebote zur Förderung von Transfertätigkeiten innerhalb und außerhalb wissenschaftlicher Einrichtungen (durch die Befähigung (akademischer) Fachkräfte spielen können und soll(t)en, um Partizipation verschiedener Stakeholder z.B. in transdisziplinären Projekten umzusetzen oder Anwendungsorientierung in Forschung und Lehre zu stärken. Damit schließt die Diskussionsveranstaltung an die Entwicklung von Indikatoren zur Messung von Transferleistungen und deren Integration in die Leistungsbewertung von Wissenschaftler:innen an. Vor diesem Hintergrund wird das Ziel verfolgt, gemeinsame Bezugspunkte herauszuarbeiten, Beispiele zu geben und Best Practices zu identifizieren sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die Weiterbildung und Qualifizierung von Wissenschaftler:innen zu erarbeiten, um Kapazitäten im Bereich des Transfers zu stärken.
| ||||||
| 11:15 - 12:45 | Dynamisierung von Grenzen Ort: D0433 Chair der Sitzung: Ralf Blasek, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Workshop | ||||||
|
|
Weiterbildung einrichtungsübergreifend stärken: neue Wege innerhochschulischer Einflussnahme und Strategieentwicklung PH Heidelberg, Deutschland Mit der „Zukunftswerkstatt Weiterbildung“ hat die PH Heidelberg im Kontext des Förderprogramms Hochschulweiterbildung@BW seit 2023 ein Instrument zur strategischen Neuausrichtung der wiss. Weiterbildung entwickelt. Das mit Unterstützung der Hochschulleitung aufgesetzte Instrument hat zum Ziel, vor dem Hintergrund der Vielzahl der an der Hochschule an der Weiterbildung beteiligten Akteur:innen eine gemeinsame Strategie für die wiss. Weiterbildung zu verfolgen, ein einheitliches Anbieterverständnis zu entwickeln und die Wahrnehmung der Weiterbildung in und außerhalb der Hochschule in einem bottom-up Prozess zu stärken. Dafür sollen auf Basis eines tiefergehenden gegenseitigen Verständnisses gemeinsame Standards geschaffen und klare Zuständigkeiten über die Bereiche Weiterbildung und Transfer hinweg etabliert werden. Perspektivisch soll darüber auch gemeinsam Einfluss auf Ressourcenverteilung und Rahmenbedingungen genommen werden. Die unterschiedlichen Zugänge, die die Beteiligten zur Weiterbildung haben, stellen nach wie vor eine Herausforderung dar. Dennoch konnten als konkrete Ergebnisse bereits der Markenkern der Weiterbildung beschrieben sowie ein auf dem Raster der DGWF aufbauendes PH-spezifisches Transparenzraster entwickelt und mehr Abstimmung im Alltagsgeschehen erreicht werden. In dem Workshop wollen wir zentrale Erfahrungen aus dem bisherigen Prozess vorstellen und mit den Teilnehmenden diskutieren:
| ||||||
| 11:15 - 12:45 | Dynamisierung von Angeboten Ort: D0436 Chair der Sitzung: Heike Bartholomäus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Workshop | ||||||
|
|
Dynamiken bei der Entwicklung von wissenschaftlicher und künstlerischer Weiterbildung 1Universität Potsdam; 2BTU Cottbus-Senftenberg; 3Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin; 4Universität der Künste Berlin; 5Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Wissenschaftlich und wissenschaftlich künstlerische Weiterbildung antwortet in der Angebotsentwicklung wachsenden Herausforderungen in einer sich stetig veränderten Arbeitswelt in einer sich wandelnden Gesellschaft. Neben der rasanten Transformation durch Digitalisierung wirken auch die Megathemen Migration sowie Klima und Nachhaltigkeit als Impulsgeber für Weiterbildungsbedarf. Diese wirken in Themen ein, verändern Angebotsinhalte und -formate und bieten auch Anlass für neue Kooperationen zwischen Weiterbildungsanbietenden und Akteuren in Gesellschaft und Wirtschaft. Angesichts der veränderten Anforderungen auf dem Weiterbildungsmarkt ist es für hochschulische Weiterbildungsanbieter unabdingbar, mit geeigneten Angeboten aktuelles Wissen in die Praxis zu integrieren und ihre Rolle bewusst einzunehmen. Die Entwicklung und Anpassung von Weiterbildungsangeboten ist bedarfsorientiert. Aus der Sicht der Angebotsentwicklung ist es erforderlich, Bedarfsentwicklungen frühzeitig zu erkennen und Angebote eigenständig oder in Kooperation mit weiteren Akteuren zu konzipieren. Im Workshop-Format eines World Cafés soll an Thementischen mit interessierten Teilnehmenden ein Austausch zu Methoden, Vorgehensweisen und Tools stattfinden, um zukünftige Bedarfe und Bedarfsverschiebungen in den Weiterbildungsangeboten frühzeitig zu erkennen und Weiterbildungsangebote entsprechend innovieren zu können. Ziel ist es, den Austausch fachlicher Expertise anzuregen und ein Netzwerk von Expert*innen zu gründen, dass sich gegenseitig bei der Weiterbildungskonzeption unterstützt. Die Ergebnisse des Workshops werden als Handlungsempfehlungen zusammengefasst und den Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt.
| ||||||
| 11:15 - 12:45 | Dynamisierung von Angeboten Ort: D0431 Chair der Sitzung: Sabine Betz-Ungerer, Technische Hochschule Nürnberg Workshop | ||||||
|
|
Co-Kreation in der wissenschaftlichen Weiterbildung: Professionalität wahren in ungeübten Settings TH Köln, Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung, Deutschland Kollaborativ entwickelte Weiterbildungen tragen effektiv zur Sicherung von Fachkräften bei und schaffen einen unmittelbaren Mehrwert, der sowohl für Organisationen als auch Teilnehmer:innen anschlussfähig und zukunftsorientiert ausgerichtet ist. Dieser Workshop beleuchtet co-kreativ angelegte Entwicklungsprozesse in der wissenschaftlichen Weiterbildung anhand dreier unterschiedlicher Projekte der TH Köln (Qualifiziert.Vernetzt.Innovativ.Wirksam - Weiterbilden im Rheinischen Revier, Co-Site, Trend Auto2030plus). Alle Projekte agieren im Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Der Wunsch eines co-kreativen Entwicklungsprozesses mit Stakeholdern aus der Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft für zukunftsorientierte, passgenaue wissenschaftlichen Weiterbildungsformate stößt immer wieder auf unterschiedliche Wirklichkeiten, wie begrenzte Zeit, Rollenverständnisse und coopetition Bereitschaft. Gemeinsam möchten wir den möglichen Handlungsrahmen in diesem Spannungsfeld für die wissenschaftliche Weiterbildung ergründen. Dabei möchten wir a) ein Rollenbild für die wissenschaftliche Weiterbildung entwickeln und b) die diversen Ansprüche eines co-kreativen Entwicklungsprozesses mit Stakeholdern aus der Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft hinterfragen. In diesem Workshop möchten wir gemeinsam lernen, wie wir durch die Unsicherheiten dieses Prozesses steuern können. Wir werden besprechen, wie wir Partner für einen gemeinsamen Entwicklungsprozess begeistern können, wie wir Einwände wie "Ja, aber..." überwinden und wie wir die nötige Offenheit, Widerstandsfähigkeit und Energie aufbringen, um uns auf kreative und ergebnisoffene Entwicklungsprozesse einzulassen.
| ||||||
| 12:45 - 13:45 | Mittagspause Ort: Ebene K7 | ||||||
| 13:45 - 14:45 | Keynote Ort: R0712 Chair der Sitzung: Jan Ihwe, Universität Freiburg Wissenschaftliche Weiterbildung im Lichte der Empfehlungen des Wissenschaftsrats Prof. Dr. Birgit Spinath, Wissenschaftsrat, Vorsitzende des Ausschusses Tertiäre Bildung | ||||||
| 14:45 - 15:00 | Thematische Schwerpunkte der DGWF 2024 Ort: R0712 Chair der Sitzung: Prof. Dr. Annika Maschwitz, Hochschule Bremen World-Café + Pitches | ||||||
| 15:00 - 15:20 | Kaffeepause / Raumwechsel Ort: Gebäude D Ebene 4 | ||||||
| 15:20 - 16:45 | Herausforderungen und Chancen der Internationalisierung in der wissenschaftlichen Weiterbildung Ort: D0431 Chair der Sitzung: Jan Ihwe, Universität Freiburg Chair der Sitzung: Dr. Monica Bravo Granström, Pädagogische Hochschule Weingarten Eine Analyse der letzten fünf Jahre Thematischer Schwerpunkt der DGWF 2024 I. | ||||||
|
|
Internationale Kooperation am Beispiel des Studiengangs Artificial Intelligence for Connected Industries Universität Ulm und Technische Hochschule Ulm, Deutschland Das Joint Master Programm im Rahmen des EU-Projektes "Artificial Intelligence for Connected Industries" (AI4CI) ist ein gelungenes Beispiel für eine Kooperation auf internationaler Ebene, die konsekutive und weiterbildende Master verknüpft. Für die Durchführung des Studiengangs AI4CI bündeln die Cnam, die Cnam Grand-Est. und die Avignon Université aus Frankreich, die Universitat Politècnica de Catalunya aus Spanien, die Universitatea Babeș-Bolyai aus Rumänien, die National Technical University of Ukraine aus der Ukraine und die Universität Ulm aus Deutschland Fachwissen und Ressourcen, um ein hochwertiges Ausbildungsprogramm anzubieten. Die Kooperation für das Joint Master Programm umfasst mehrere wichtige Aspekte:
Im Vortrag werden Herausforderungen und Chancen bei der Entwicklung des internationalen Master Programms aufgegriffen, welches im WiSe24/25 bereits bei einigen Partnerhochschulen startet. | ||||||
| 15:20 - 16:45 | Verhältnis wissenschaftlicher zur beruflichen Weiterbildung Ort: D0435 Chair der Sitzung: Dr. Alexandra Jürgens, Hochschule Aalen Graduate Campus Chair der Sitzung: Heike Bartholomäus, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Thematischer Schwerpunkt der DGWF 2024 II. | ||||||
| 15:20 - 16:45 | Verständnis und Entwicklungen der wissenschaftlichen Weiterbildung Ort: D0436 Chair der Sitzung: Prof. Dr. Annika Maschwitz, Hochschule Bremen Chair der Sitzung: Andreas Kröner, DGWF e.V. Thematischer Schwerpunkt der DGWF 2024 III. | ||||||
| 15:20 - 16:45 | Gesellschaftliche Öffnung und die Bedeutung für die Strukturen und Organisationsformen wissenschaftlicher Weiterbildung Chair der Sitzung: Ralf Blasek, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Chair der Sitzung: Jürgen Scholz, Ruhr Campus Academy gGmbH Thematischer Schwerpunkt der DGWF 2024 IV. | ||||||
|
|
Entwicklung eines flexibilisierten, bedarfsorientierten & berufsbegleitenden Lernangebots Frankfurt University of Applied Sciences, Deutschland Gesellschaftliche Veränderungen, Fachkräftemangel, Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelten erfordern den stetigen Ausbau eigener Kompetenzen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns das Ziel gesetzt, flexibel gestaltete und bedarfsorientierte Lernangebote zu entwickeln, die in einer speziellen Zertifikatssystematik innerhalb der wissenschaftlichen Weiterbildung verankert sind. Unser Ansatz zielt darauf ab, individuelle Lernbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und Bildungsangebote zu schaffen, die es den Lernenden ermöglichen, sich gezielt weiterzuentwickeln. Diese Lernangebote sollen nicht nur isoliert stehen, sondern auch die Möglichkeit bieten, innerhalb eines flexibilisierten Masterprogramms auf einen entsprechenden hochschulischen Abschluss hinzuarbeiten. Im Fokus stehen die Formate Certificate of Advanced Studies (CAS) und Diploma of Advanced Studies (DAS), angelehnt an das Transparenzraster der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien. Eine Anerkennung dieser Zertifikate auf einen Studienabschluss soll im Sinne der Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit von Bildungsangeboten gewährleistet werden. Auch widmen wir uns bereits dem Thema Microcredentials und entwickeln kleinteilige Lehr- und Lernangebote. In allen Fällen stehen die Kompetenzentwicklung in Bezug auf gesellschaftlich relevant (Zukunfts-)Themen sowie interdisziplinäre Ansätze und Methoden im Vordergrund der konzipierten Lernangebote. Der Vortrag gibt eine Standortbestimmung zur Entwicklung flexibilisierter Weiterbildungsangeboten an der Frankfurt University of Applied Sciences.
| ||||||
| 15:20 - 16:45 | Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte als Handlungsfeld Ort: D0433 Chair der Sitzung: Dr. Ulrich Wacker, Universität Konstanz Thematischer Schwerpunkt der DGWF 2024 V. | ||||||
|
|
Erfolgsfaktoren und Lessons Learned einer umfangreichen berufsbegleitenden Nachqualifizierung von Informatiklehrkräften im Blended-Learning-Format Universität Konstanz, Deutschland Der Bedarf an berufsbegleitenden Nachqualifizierungsangeboten für Lehrkräfte steigt rasant an, so auch in der Informatik. Universitäten können hierbei zentrale Akteure sein, die forschungsnah und gleichzeitig unterrichtsorientiert Lehrkräften in innovativen Formaten die notwendigen Kompetenzen vermitteln. Herausforderungen bei der Entwicklung und Durchführung dieser Angebote ist die große Heterogenität der Teilnehmenden in Bezug auf Vorkenntnisse, Vereinbarkeit mit beruflichen und privaten Verpflichtungen, die hohe Arbeitsbelastung im Beruf der Lehrkraft und eine weite geografische Verteilung der Teilnehmenden. Erforderlich ist deshalb ein hohes Maß an Flexibilität. Seit 2018 bieten wir vor diesem Hintergrund ein Bologna-kompatibles Blended-Learning-Programm im Umfang von 5 ECTS Credits, das jährlich rund 200 Lehrkräfte im Fach Informatik nachqualifiziert. Trotz des hohen Arbeitsaufwands und des umfassenden Inhaltsumfangs liegt die Abbruchquote bei weniger als 2 % bei einer sehr hohen Gesamtzufriedenheit von über 94 %. In unserem Beitrag stellen wir Konzept und Struktur des „Microcredentials Kontaktstudium IMP“ vor. Wir skizzieren unsere Erfahrungen und präsentieren die Auswertung einer Nachbefragung unter den bisherigen Teilnehmenden mit 327 ausgefüllten Fragebögen, Wir erläutern 27 identifizierte Erfolgsfaktoren, die Konzepten der Lehrkräftefortbildung im Blended-Learning-Formateine Referenz bieten können. Schließlich diskutieren wir am Beispiel des Kontaktstudium IMP, wie innovative berufsbegleitende Studienangebote zur Dynamisierung der Rolle der Universitäten in der Weiterbildung für Lehrkräfte beitragen können. | ||||||
| 16:45 - 17:15 | Kaffeepause / Raumwechsel Ort: Gebäude D Ebene 4 | ||||||
| 16:45 - 17:15 | Mandatsprüfung Mitgliederversammlung 2024 Ort: R0512 | ||||||
| 17:00 - 18:30 | Rahmenprogramm: Führung „Kunst am Bau“ Gelände der Universität Konstanz | ||||||
| 17:00 - 18:30 | Rahmenprogramm: Stadtführung „Klassische Sehenswürdigkeiten in Konstanz" | ||||||
| 17:15 - 19:00 | Mitgliederversammlung 2024 Ort: R0712 | ||||||
| 17:30 - 18:15 | Rahmenprogramm: Hafenrundfahrt im Konstanzer Trichter mit dem Linienverkehrs Schiff | ||||||
| 19:15 | Conference-Dinner / Get Together ab 19:15Uhr Holly’s Reichenaustraße 19 a D-78467 Konstanz Für das Conference-Dinner gilt die reguläre Karte Zur Karte-> | ||||||
| Datum: Freitag, 13.09.2024 | |||||||
| 8:30 - 13:00 | Öffnung Registrierungsdesk mit Tagungsservice Ort: Gebäude R Ebene 5 | ||||||
| 9:30 - 9:45 | Begrüßung Ort: R0712 Begrüßung durch die lokale Tagungsorganisation und dem Vorsitz der DGWF | ||||||
| 9:45 - 10:15 | Dissertationspreis Ort: R0712 Chair der Sitzung: Prof. Dr. Olaf Dörner, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Die DGWF zeichnet 2024 zwei Arbeiten aus | ||||||
| 10:15 - 10:30 | Kaffeepause / Raumwechsel | ||||||
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Angeboten – Qualitätssicherung Ort: D0433 Chair der Sitzung: Ralf Blasek, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Vorträge | ||||||
|
|
Grenzen überwinden und neue Angebote implementieren - Qualitätssicherung für digitale Bildung und Microcredentials FIBAA, Deutschland Wo finanzielle, familiäre, gesundheitliche, räumliche oder zeitliche Faktoren den Zugang zu Bildung und Weiterbildung beschränken, können Hochschulen mit Hilfe von Microcredentials und Online-Bildungsangeboten niedrigschwellige Angebote schaffen, nicht traditionelle Zielgruppen erreichen und so Bildungsformate flexibilisieren sowie ihr Angebot dynamisieren. Dabei spielt die Qualitätssicherung eine wichtige Rolle. Koordinierte interne und externe Qualitätssicherungssicherungsverfahren von Online-Weiterbildung und Microcredentials unterstützen die Vergleichbarkeit mit und die Anrechenbarkeit zu traditionellen und formalen Bildungsangeboten. Das Qualitätsmanagement wird damit zur Grundlage für Hochschulen, die ihr Angebot an Microcredentials und digitaler Bildung nachhaltig und skalierbar aufstellen wollen. Auf Basis der Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum (ESG) benennt der Vortrag spezifische Aspekte der Qualitätssicherung digitaler Programme und Microcredentials. Es werden Besonderheiten von Zielgruppen und Qualifikationszielen vorgestellt, Besonderheiten der Erstellung didaktischer Konzepte, der Sicherstellung von qualifiziertem Lehrpersonal, der Konzeption der Inhalte, der Sicherstellung der technischen Infrastruktur sowie Fragen zur kontinuierlichen Evaluation, Erfolgskontrolle und Weiterentwicklung des Bildungsangebots. Darüber hinaus wird auf Schnittstellen, Redundanzen, Abgrenzungen und Übergänge zu traditionellen Bildungsangeboten (Präsenzunterricht, Studiengänge mit akademischem Abschluss) eingegangen sowie die Einbindung des Bildungsangebotes in die Gesamtstrategie der Hochschule thematisiert.
Zertifizierungsverfahren Revisited - Herausforderungen und Lösungsansätze in der Qualitätsentwicklung und Professionalisierung in der wissenschaftlichen Weiterbildung in Baden-Württemberg EVALAG (Evaluationsagentur Baden-Württemberg), Deutschland Angesichts der steigenden Relevanz des Umgangs mit Wissen ergibt sich ein Bedarf an qualitativ hochwertigen Angeboten der wissenschaftlichen Weiterbildung. Dieser Vortrag widmet sich der Frage, wie Qualität und Professionalität in der wissenschaftlichen Weiterbildung ermöglicht werden können und legt dabei einen Fokus auf das Potenzial von Zertifizierungsverfahren und Professionalisierungsangeboten. Diese Fragestellung ergibt sich im Rahmen der Qualitätsentwicklung im Projekt Hochschulweiterbildung@BW (2022-2024), die EVALAG (Evaluationsagentur Baden-Württemberg) verantwortet. Um diese Frage zu beantworten, wurden im September 2023 (n=8) und März 2024 (n=6) zwei Fokusgruppeninterviews mit Vertreter:innen der Einrichtungen der wissenschaftlichen Weiterbildung in Baden-Württemberg durchgeführt. Dabei wurde eine möglichst große Heterogenität des Samples hinsichtlich Region, Beruf (z.B. Programmplanung, Qualitätsmanagement, Verwaltung, Hochschulleitung) sowie Geschlecht angestrebt. Die qualitativ ausgewerteten Ergebnisse reflektieren die Relevanz und das Potenzial von Zertifizierungsverfahren innerhalb von Einrichtungen sowie von Kooperationen in der zugleich bestehenden Wettbewerbssituation mit bzw. zu anderen Anbieter:innen. Die Analyse zeigt zudem einen Bedarf an Flexibilität und Agilität um möglichst schnell auf die Bedarfe des Marktes reagieren zu können. Weiter deuten die empirischen Erkenntnisse auf die Bedeutung von Vernetzung, Kooperation und Austausch innerhalb der Einrichtungen hin und auf den Beitrag, den Professionalisierungsangebote mit Hands-On Wissen und für eine zielgruppenspezifische Didaktik leisten können.
| ||||||
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Strukturen – Governance Ort: D0434 Chair der Sitzung: Prof. Dr. Annika Maschwitz, Hochschule Bremen Vorträge | ||||||
|
|
Governance Wissenschaftlicher Weiterbildung Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), Deutschland Antworten auf die im Call for Papers der DGWF-Tagung 2024 aufgeworfene Frage, wie die Steuerung der wissenschaftlichen Weiterbildung in die komplexen Entscheidungsprozesse einer Hochschule effektiv integriert werden kann, sind für die Realisierung von Erwartungsstrukturen ihrer Umwelt und damit für die Zukunft der Weiterbildung relevant. Im Mittelpunkt des Beitrags steht ein Vorschlag, der auf Ergebnissen meiner Forschung zur institutionellen und organisationalen, insbesondere rechtlichen Ausgestaltung des Weiterbildungssystems Schweizer Hochschulen basiert. Methodologisch macht diese vom soziologischen Neo-Institutionalismus und der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie Gebrauch (Walgenbach & Meyer 2008; Meyer et al. 2005; Meier 2009). Die Ansätze ermöglichen es, theoretisch zwischen den ‚Studienangeboten der wissenschaftlichen Weiterbildung als Institutionen‘ und der ‚Wissenschaftlichen Weiterbildung als Organisation‘ zu differenzieren. DiMaggio (1991) hält es für gewinnbringend, die organisationale Strukturation und die Strukturierung des organisationalen Feldes zu analysieren. Er hebt die Bedeutung autorisierter Akteure hervor sowie von Ressourcen, die für den Wandel des organisationalen Feldes genutzt werden können. Die Schweizer Hochschulen steuern durch sog. Weiterbildungsreglements die Organisation der Weiterbildung sowie die in einem ca. zehnjährigen Prozess entwickelten landesweit einheitlichen Weiterbildungsabschlüsse. Am Beispiel eines Weiterbildungsreglements werden rechtliche Strukturen, autorisierte Akteure und Ressourcen sowie die Relationen zwischen der organisationalen Strukturation und der Institutionalisierung der Studienangebote verdeutlicht.
Wissenschaftliche Weiterbildung und Regelungen zur hochschulischen Kapazität – wenn der Kreis kein Quadrat werden will… Universität Potsdam Das Thema der Berücksichtigung von wissenschaftlicher Weiterbildung in der hochschulischen Kapazitätsberechnung ist in der Fachcommunity ein „Dauerbrenner“. Die HRK nahm es in diesem Jahr bereits in einem Fachworkshop auf. Auch nach den Ergebnissen der im Rahmen des AG-E-Projekts zu Zertifikatsangeboten durchgeführten Befragung wünscht sich eine signifikante Anzahl des in der wissenschaftlichen Weiterbildung tätigen Personals eine Rechtsänderung insoweit, dass die Lehre in der wissenschaftlichen Weiterbildung (anteilig) auf Lehrdeputate angerechnet werden könne. Längst werden in Konzepte des lebenslangen Lernens Angebote einbezogen, die sich in die vermeintlich zementierten Kategorien „weiterbildend oder nichtweiterbildend“ schlecht einsortieren lassen – und die bei der Frage der Berücksichtigung in den hochschulischen Kapazitäten an die zwischen den Kategorien verlaufenden Grenzen stoßen. Im Vortrag werden die Grundlagen und Auswirkungen des Zusammenspiels von Landeshochschulgesetzen, der Kapazitätsverordnungen und der Lehrverpflichtungsverordnungen erläutert. Mit einer differenzierenden Darstellung des Themenfeldes für „Nichtjurist*innen“ wird eine fachlich fundierte Grundlage geschaffen und damit ein Beitrag zu einem informierten Diskurs über einen Regelungsrahmen geleistet, der von vielen Akteur*innen in der wissenschaftlichen Weiterbildung als stark beschränkend empfunden wird. Damit soll kann die Basis für eine Diskussion entstehen, in der rechtliche Grenzen und Gestaltungsräume verstanden und von politischen Zielvorgaben differenziert werden können.
Der Plattformbegriff in der wissenschaftlichen Weiterbildung – Befunde aus einem internationalen Scoping Review Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland Im Zuge des gesamtgesellschaftlichen Phänomens der Digitalisierung erhalten Plattformen verstärkt Einzug in Privatleben, Arbeit und (Digital-)Wirtschaft. Den Bedeutungszuwachs von Digitalunternehmen und den „damit verbundene[n] Prozess des fortschreitenden Eindringens infrastruktureller und regelsetzender Plattform-Elemente in die Internet-Ökosysteme“ (S. 17) ordnen Eisenegger et al. (2021) als digitalen Strukturwandel im Zuge der sogenannten Plattformisierung ein. Hierbei nehmen digitale Plattformen eine dynamisierende Rolle ein, indem sie neue Möglichkeiten für die Gestaltung digitaler und analoger Handlungsräume eröffnen und geografische Begrenzungen teilweise auflösen. Dies gilt auch für die wissenschaftliche Weiterbildung, die in ihrer spezifischen Positionierung Bezüge sowohl zum Hochschulsystem als auch zum Weiterbildungsmarkt aufweist: Anbieter bauen eigene Plattformstrukturen auf (z.B. südwissen, WIBKO®), was Einfluss auf die Strukturentwicklung wissenschaftlicher Weiterbildung ausübt. Zudem agieren vermehrt privatwirtschaftliche Digitalunternehmen als Plattformbetreiber im Feld. Bislang fehlt eine Systematisierung, um das vage Konzept Plattform im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung thematisch zu fassen. Über ein internationales Scoping Review werden im Beitrag bestehende Forschungsarbeiten im deutsch- und englischsprachigen Diskurs systematisch ausgewertet, um eine Standortbestimmung des Plattformisierungsdiskurses vorzunehmen. Anschließend werden Implikationen für das Handlungsfeld der wissenschaftlichen Weiterbildung herausgearbeitet. Eisenegger, M., Prinzing, M., Ettinger, P., & Blum, R. (2021). Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit. Springer VS.
| ||||||
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Grenzen – Kooperation Ort: D0436 Chair der Sitzung: Thomas Bertram, Leibniz Universität Hannover Vorträge | ||||||
|
|
Das Gast- und Seniorenstudium als Gegenstand eines Forschungsseminars an der Philipps-Universität Marburg. Ein Beispiel einer erfolgreichen und dynamischen inneruniversitären Kooperation Philipps-Universität Marburg, Deutschland An der Philipps-Universität Marburg wird im WiSe 2023/24 und im SoSe 2024 am Institut für Soziologie das Forschungsseminar „Das Gaststudium aus bildungssoziologischer Perspektive“ als Teil des Moduls „Empirisches Lehrforschungsprojekt“ angeboten. Die Studierenden wenden im Rahmen des Seminars ihre vorher erworbenen Kenntnisse der quantitativen Methoden der empirischen Sozialforschung selbst an, indem sie über zwei Semester an einem Projekt arbeiten, Daten erheben und auswerten. Forschungsgegenstand ist das Gast- und Seniorenstudium an der Universität Marburg und an weiteren Standorten in Deutschland. Der Vortrag beleuchtet die Entstehungsgeschichte von der Idee über die Konzeption und Umsetzung des Forschungsseminars bis hin zu ersten Ergebnissen der Befragung der Zielgruppe. Im Zentrum des Vortrags steht, welche Rolle die verschiedenen Akteure (Studierende, Gasthörer*innen, Referentin aus der Verwaltung, Dozent) im Forschungsprozess übernommen haben. Vor allem wird der intensive und fruchtbare Austausch- und Lernprozess sowie der Einfluss dieser Akteure auf den Forschungsprozess inklusive Forschungsdesign, Forschungsfragen und -hypothesen beschrieben. Dargestellt wird u.a., wie die Akteure aus Verwaltung und Fachbereich von den jeweiligen Kompetenzen der anderen Seite profitiert haben. Bei der Analyse des Wissenstransfers werden idealtypisch zwischen interaktionsspezifischen, wissensspezifischen, individuellen und organisationalen Einflussfaktoren unterschieden (s. Blank et al 2015). Letztendlich wird ein Beispiel einer erfolgreichen und dynamischen inneruniversitären Kooperation zwischen dem regulären Studium und der wissenschaftlichen Weiterbildung Älterer gezeigt. Grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Wissenschaftlichen Weiterbildung: Gestaltung disziplinübergreifender Angebote. TU Dresden, Deutschland Wissenschaftliche Weiterbildung wird häufig als Inter- bzw. Transdisziplinär charakterisiert, bedingt durch ihre intermediäre Position zwischen Systemlogiken (Alexander, 2022), Akteur:innen mit heterogenen Hintergründen (Jütte & Lobe, 2022) und Lehr-Lernsettings (Habeck, 2021). Zudem ist ein Begriffswandel von Inter- zu Transdisziplinarität erkennbar, was nicht nur die wissenschaftliche Weiterbildung im Speziellen, sondern Wissenschaft im Gesamten betrifft. Die Diskussion um disziplinübergreifende Praktiken in der wissenschaftlichen Weiterbildung findet meist als Selbstreflexion des Forschungsfeldes statt, vernachlässigt jedoch das Praxisfeld, was im Kontrast zur organisationalen Verortung der wissenschaftlichen Weiterbildung steht, welche meist quer zur disziplinären Struktur der Hochschulen liegt. Die Betrachtung von Inter- bzw. Transdisziplinarität im Praxisfeld wissenschaftliche Weiterbildung rückt deren Gestaltung und Relevanz sowie die intra- und extrauniversitären Kooperationsprozesse zur gegenseitigen Grenzüberschreitung in den Blick. Der Beitrag thematisiert basierend auf ersten Ergebnissen eines qualitativen Projekts anhand weiterbildender Masterprogramme, wie Interdisziplinarität im Feld verstanden wird und aus organisationaler Perspektive gestaltet werden können. Alexander, C. (2022). Wissenschaftliche Weiterbildung und ihre besondere Positionierung. ZHWB, 2, 16–21. Habeck, S. (2021). Interdisziplinarität in Veranstaltungen der wissenschaftlichen Weiterbildung. Hessische Blätter für Volksbildung, 3. Jütte, W., & Lobe, C. (2022). Stichwort: Disziplinäre und wissenschaftliche Verortungen in der wissenschaftlichen Weiterbildung. ZHWB, 2.
(Steuerungs-) Dynamiken in der Kooperation für ein regionales und digitales Weiterbildungsmarketing – Befunde aus der Begleitforschung zum Projektverbund Hochschulweiterbildung@BW Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland Im Rahmen der aktuellen Weiterbildungsoffensive in Baden-Württemberg hat der Projektverbund Hochschulweiterbildung@BW die hochschulübergreifende digitale Marketingplattform südwissen sowie ein Netzwerk von 25 Regional- und Fachvernetzungsstellen an insgesamt 48 Hochschulen etabliert. Auf diese Weise soll das Matching zwischen den Bedarfen der Wirtschaft und dem Weiterbildungsangebot der Hochschulen verbessert sowie insgesamt das Bildungsmarketing und die Angebots- und Kooperationsstrukturen der wissenschaftlichen Weiterbildung strukturell gestärkt werden. Die wissenschaftliche Begleitforschung des Projektverbunds unter dem Projekttitel GOMA@BW zielt darauf ab, Erkenntnisse über die gegenwärtige Strukturentwicklung und den Wandel von Governance-, Organisations-, Marketing- und Angebotsformen in der wissenschaftlichen Weiterbildung zu gewinnen. Auf Basis eines Mixed-Methods-Forschungsdesigns wurden teilstandardarisierte offene Interviews mit den unterschiedlichen Projektbeteiligten (Regional- und Fachvernetzer:innen, Einrichtungsleitungen, Projektmanagement/-leitung) geführt sowie Dokumentenanalysen und eine umfassende quantitative Befragung aller Regional- und Fachvernetzer:innen umgesetzt. Im Rahmen der DGWF-Jahrestagung möchten wir zentrale Ergebnisse aus den verschiedenen Forschungszugängen vorstellen. Erste Auswertungen geben Einblicke in die dynamischen (neuen und bereits bestehenden) regionalen Kooperationsstrukturen und verweisen auf vielfältige (Steuerungs-) Dynamiken zwischen den beteiligten Akteuren und Bezugsebenen des Projektverbunds rund um das gemeinsame regionale und digitale Weiterbildungsmarketing.
| ||||||
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Strukturen Ort: D0432 Chair der Sitzung: Andreas Dörich, oncampus GmbH Workshop | ||||||
|
|
Microcredentials - Eine Annäherung an ein konsistentes System und Implementierung in Aus- und Weiterbildung 1Universität Bern, Schweiz; 2ETH Zürich, Schweiz Die Publikation der Europäischen Kommission zu Micocredentials[1] hat zu einer hohen Dynamik, sowohl bezüglich der Entwicklung von neuen Angeboten wie auch der Schaffung von Rahmenbedingungen, geführt. Auch in der Schweiz wurden vor allem im Bereich Weiterbildung rasch erste Positionen bezogen, spezifisch von Swissuni[2] und später auch von den Kommissionen der weiteren Hochschultypen. Seit Herbst 2023 gibt es eine Arbeitsgruppe von swissuniversities zum Thema, welche den Einsatz von Microcredentials sowohl in Aus- wie auch Weiterbildung betrachtet. Gleichzeitig finden bei den Institutionen verschiedene Aktivitäten zur Regelung des Umgangs mit und zur Etablierung von Microcredentials statt. An der Universität Bern hat sich die Weiterbildungskommission auf Initiative des Zentrums für universitäre Weiterbildung (ZUW) im Oktober 2023 - und damit vor einer Klärung der Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene - zum ersten Mal mit Microcredentials befasst. Das ZUW lanciert 2024 erste Pilotprojekte. An der Universität Bern wurde eine agile Arbeitsweise gewählt, bei der verschiedene Stakeholder kooperativ zusammenarbeiten, um das «Microcertificate of Advanced Studies, Universität Bern» zu entwickeln und zu implementieren. So kann der hohen Dynamik begegnet und flexibel auf nationale Entwicklungen reagiert werden. An der ETH Zürich geht man einen anderen Weg: Angestrebt wird ein die Aus- und Weiterbildung vereinendes Konzept, das bald finalisiert werden soll. Im Rahmen dieses Beitrags werden die Dynamiken, Herausforderungen und Chancen von parallel in verschiedenen Institutionen und nationaler Ebene stattfindenen Prozessen beleuchtet und der aktuelle Stand der Arbeiten diskutiert.
| ||||||
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Strukturen Ort: Y0311 Chair der Sitzung: Prof. Dr. Christoph Damm, Hochschule Magdeburg-Stendal Workshop | ||||||
|
|
Microcredentials für Future Skills: Chancen und Herausforderungen für die Hochschulbildung Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Deutschland (Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung ZWW) Im Workshop wird der Fokus auf die Konzeption und Implementierung von Microcredentials zur Förderung von Future Skills in der Hochschulbildung gelegt. Dabei werden die mit der Einführung von Microcredentials verbundenen Chancen und Herausforderungen präsentiert, während Raum für interaktive Diskussionen und Fallbeispiele geboten wird. Der Workshop gliedert sich in mehrere Abschnitte. Zunächst wird die Bedeutung von Microcredentials als kompakte Lerneinheiten mit besonderem Blick auf die Zielgruppen Studierende, Hochschullehrende und -fachkräfte erläutert. Anschließend wird in das Konzept der Future Skills eingeführt und ihre Relevanz für die zukünftige Arbeitswelt aufgezeigt. Die potenziellen Vorteile von Microcredentials, wie Flexibilität und Personalisierung des Lernens, werden diskutiert und Beispiele erfolgreicher Anwendungen präsentiert. Dabei werden die Teilnehmenden ermutigt, ihre eigenen Erfahrungen und Ideen einzubringen. Des Weiteren werden die Herausforderungen bei der Implementierung von Microcredentials, wie Validierung und Integration in Curricula, behandelt. In Gruppendiskussionen werden mögliche Lösungsansätze für diese Herausforderungen erarbeitet. Außerdem zeigen Best Practices und Fallbeispiele die erfolgreiche Implementierung von Microcredentials und ihre Übertragbarkeit auf andere Institutionen wird analysiert. Zum Abschluss werden Inputs zu Integrationsstrategien, wie Kooperationen mit externen Partnern sowie Anerkennungs- und Anrechnungsmöglichkeiten, gegeben. In einer Abschlussdiskussion werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und die Teilnehmenden ermutigt, die diskutierten Ideen in ihren eigenen Institutionen umzusetzen.
| ||||||
| 10:30 - 12:00 | Dynamisierung von Grenzen Ort: D0431 Chair der Sitzung: Madeline Lockstedt, Philipps-Universität Marburg Workshop | ||||||
|
|
Wissenschaftliche Weiterbildung: Stärkung durch strategische Verankerung im Transfer Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, Deutschland Wissenschaftliche Weiterbildung ist an vielen Hochschulen noch ein marginalisiertes Thema. Es wird u.a. durch die Arbeit von Career Centers und Weiterbildungsinstituten, der Personalentwicklung, dem Dualen Studium oder Transferaktivitäten adressiert – eine strategische Aufstellung, die synergistische Effekte dieser Wege nutzt, ist meist nicht präsent. Da die wissenschaftliche Weiterbildung ein wichtiges Transfer-Instrument darstellt, birgt sie das Potenzial durch eine Stärkung des Transfers und eine Verankerung in der Transferstrategie verstärkt in den Fokus der hochschulstrategischen Aufstellung zu rücken. Stifterverband Change wird in diesem Workshop einen Weg skizzieren, wie wissenschaftliche Weiterbildung im Rahmen von Transferaktivitäten und der Transferstrategie strukturell an Hochschulen gestärkt werden kann. Um dies zu erreichen, wird auf das praxiserprobte Wissen rund um das Transferbarometer des Stifterverbands, wie auch individuelle Einblicke aus den Erfahrungen der Transfer- und Weiterbildungsaudits, und der Strategieberatungen des Stifterverbands zurückgegriffen. Mittels strategisch-methodischer Herangehensweise wird der Workshop sowohl die individuelle Standortbestimmung als auch die strategische Weiterentwicklung von wissenschaftlicher Weiterbildung als zentraler Komponente des Transfers an Hochschulen behandeln. Teilnehmenden werden wertvolles Wissen, best-practice Beispiele und praktische Übungen zu ihrer eigenen Hochschule vermittelt, um wissenschaftliche Weiterbildung als eine zentrale Komponente der third mission von Hochschulen zu stärken.
| ||||||
| 12:00 - 12:30 | Kaffeepause / Raumwechsel | ||||||
| 12:30 - 13:15 | Tagungsabschluss Ort: R0712 Tagungsabschluss und Ausblick auf die DGWF Jahrestagung 2025 in Hannover
| ||||||
|
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: DGWF-JATA 2024 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.153 © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |