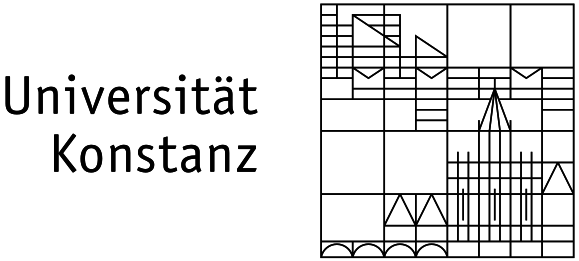Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
Bitte beachten Sie, dass sich alle Zeitangaben auf die Zeitzone des Konferenzortes beziehen.
Die momentane Konferenzzeit ist: 01. Juli 2025 02:19:58 MESZ
|
|
|
Sitzungsübersicht |
| Sitzung | ||||||
Dynamisierung von Strukturen – Governance
Vorträge
| ||||||
| Präsentationen | ||||||
Governance Wissenschaftlicher Weiterbildung Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), Deutschland Antworten auf die im Call for Papers der DGWF-Tagung 2024 aufgeworfene Frage, wie die Steuerung der wissenschaftlichen Weiterbildung in die komplexen Entscheidungsprozesse einer Hochschule effektiv integriert werden kann, sind für die Realisierung von Erwartungsstrukturen ihrer Umwelt und damit für die Zukunft der Weiterbildung relevant. Im Mittelpunkt des Beitrags steht ein Vorschlag, der auf Ergebnissen meiner Forschung zur institutionellen und organisationalen, insbesondere rechtlichen Ausgestaltung des Weiterbildungssystems Schweizer Hochschulen basiert. Methodologisch macht diese vom soziologischen Neo-Institutionalismus und der neoinstitutionalistischen Organisationstheorie Gebrauch (Walgenbach & Meyer 2008; Meyer et al. 2005; Meier 2009). Die Ansätze ermöglichen es, theoretisch zwischen den ‚Studienangeboten der wissenschaftlichen Weiterbildung als Institutionen‘ und der ‚Wissenschaftlichen Weiterbildung als Organisation‘ zu differenzieren. DiMaggio (1991) hält es für gewinnbringend, die organisationale Strukturation und die Strukturierung des organisationalen Feldes zu analysieren. Er hebt die Bedeutung autorisierter Akteure hervor sowie von Ressourcen, die für den Wandel des organisationalen Feldes genutzt werden können. Die Schweizer Hochschulen steuern durch sog. Weiterbildungsreglements die Organisation der Weiterbildung sowie die in einem ca. zehnjährigen Prozess entwickelten landesweit einheitlichen Weiterbildungsabschlüsse. Am Beispiel eines Weiterbildungsreglements werden rechtliche Strukturen, autorisierte Akteure und Ressourcen sowie die Relationen zwischen der organisationalen Strukturation und der Institutionalisierung der Studienangebote verdeutlicht.
Wissenschaftliche Weiterbildung und Regelungen zur hochschulischen Kapazität – wenn der Kreis kein Quadrat werden will… Universität Potsdam Das Thema der Berücksichtigung von wissenschaftlicher Weiterbildung in der hochschulischen Kapazitätsberechnung ist in der Fachcommunity ein „Dauerbrenner“. Die HRK nahm es in diesem Jahr bereits in einem Fachworkshop auf. Auch nach den Ergebnissen der im Rahmen des AG-E-Projekts zu Zertifikatsangeboten durchgeführten Befragung wünscht sich eine signifikante Anzahl des in der wissenschaftlichen Weiterbildung tätigen Personals eine Rechtsänderung insoweit, dass die Lehre in der wissenschaftlichen Weiterbildung (anteilig) auf Lehrdeputate angerechnet werden könne. Längst werden in Konzepte des lebenslangen Lernens Angebote einbezogen, die sich in die vermeintlich zementierten Kategorien „weiterbildend oder nichtweiterbildend“ schlecht einsortieren lassen – und die bei der Frage der Berücksichtigung in den hochschulischen Kapazitäten an die zwischen den Kategorien verlaufenden Grenzen stoßen. Im Vortrag werden die Grundlagen und Auswirkungen des Zusammenspiels von Landeshochschulgesetzen, der Kapazitätsverordnungen und der Lehrverpflichtungsverordnungen erläutert. Mit einer differenzierenden Darstellung des Themenfeldes für „Nichtjurist*innen“ wird eine fachlich fundierte Grundlage geschaffen und damit ein Beitrag zu einem informierten Diskurs über einen Regelungsrahmen geleistet, der von vielen Akteur*innen in der wissenschaftlichen Weiterbildung als stark beschränkend empfunden wird. Damit soll kann die Basis für eine Diskussion entstehen, in der rechtliche Grenzen und Gestaltungsräume verstanden und von politischen Zielvorgaben differenziert werden können.
Der Plattformbegriff in der wissenschaftlichen Weiterbildung – Befunde aus einem internationalen Scoping Review Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland Im Zuge des gesamtgesellschaftlichen Phänomens der Digitalisierung erhalten Plattformen verstärkt Einzug in Privatleben, Arbeit und (Digital-)Wirtschaft. Den Bedeutungszuwachs von Digitalunternehmen und den „damit verbundene[n] Prozess des fortschreitenden Eindringens infrastruktureller und regelsetzender Plattform-Elemente in die Internet-Ökosysteme“ (S. 17) ordnen Eisenegger et al. (2021) als digitalen Strukturwandel im Zuge der sogenannten Plattformisierung ein. Hierbei nehmen digitale Plattformen eine dynamisierende Rolle ein, indem sie neue Möglichkeiten für die Gestaltung digitaler und analoger Handlungsräume eröffnen und geografische Begrenzungen teilweise auflösen. Dies gilt auch für die wissenschaftliche Weiterbildung, die in ihrer spezifischen Positionierung Bezüge sowohl zum Hochschulsystem als auch zum Weiterbildungsmarkt aufweist: Anbieter bauen eigene Plattformstrukturen auf (z.B. südwissen, WIBKO®), was Einfluss auf die Strukturentwicklung wissenschaftlicher Weiterbildung ausübt. Zudem agieren vermehrt privatwirtschaftliche Digitalunternehmen als Plattformbetreiber im Feld. Bislang fehlt eine Systematisierung, um das vage Konzept Plattform im Kontext wissenschaftlicher Weiterbildung thematisch zu fassen. Über ein internationales Scoping Review werden im Beitrag bestehende Forschungsarbeiten im deutsch- und englischsprachigen Diskurs systematisch ausgewertet, um eine Standortbestimmung des Plattformisierungsdiskurses vorzunehmen. Anschließend werden Implikationen für das Handlungsfeld der wissenschaftlichen Weiterbildung herausgearbeitet. Eisenegger, M., Prinzing, M., Ettinger, P., & Blum, R. (2021). Digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit. Springer VS.
| ||||||
|
Impressum · Kontaktadresse: Datenschutzerklärung · Veranstaltung: DGWF-JATA 2024 |
Conference Software: ConfTool Pro 2.6.154 © 2001–2025 by Dr. H. Weinreich, Hamburg, Germany |